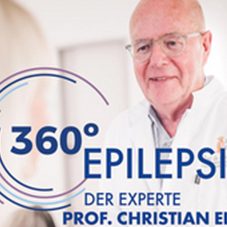Definition Epilepsie: Was ist Epilepsie?
Das Krankheitsbild der Epilepsie (zerebrales Krampfleiden) ist gekennzeichnet durch wiederkehrende, plötzliche und gleichzeitige Erregung großer Neuronen-Gruppen im Gehirn. Das menschliche Gehirn besteht aus hunderte von Milliarden miteinander verbundener Nervenzellen, die untereinander nach einem fein ausbalancierten System funktionieren. Wenn Nervenzellverbände abnorm gleichzeitig aktiv sind, ist dieses System empfindlich gestört.
Zum epileptischen Anfall kommt es, wenn eine kritische Menge der Nervenzellen abnorm aktiv ist. Dabei reichen epileptische Anfälle von äußerlich nicht oder nur kaum wahrnehmbaren subjektiven Sinnesempfindungen oder geringfügigen Muskelzuckungen über kurze Bewusstseinspausen bis hin zu Stürzen mit Bewusstseinsverlust und Zuckungen am ganzen Körper oder auffälligen automatischen Handlungen.
In der Regel dauern epileptische Anfälle einige Sekunden bis wenige Minuten. Sie hören in aller Regel ohne Behandlung spontan wieder auf. Nur selten hält ein epileptischer Anfall länger als 2-3 Minuten an. Nach 10 Minuten Dauer spricht man von einem epileptischen Status, der in der Regel eine Notfallsituation darstellt.
Von einer Epilepsie spricht man erst, wenn mindestens zwei epileptische Anfälle außerhalb von 24 Stunden aufgetreten sind und diese nicht durch eine unmittelbar vorangehende erkennbare Ursache ausgelöst wurden. Auch ein Anfall kann bereits für die Diagnose ausreichen, wenn eine Ursache bekannt ist, die weitere Anfälle in den nächsten 6 Monaten erwarten lässt.
Abzugrenzen von einer Epilepsie sind Situationen, bei denen der Patient einen provozierten Anfall erleidet. Diese Provokationen können ein massiver Schlafentzug mit oder ohne Alkohol sein oder bei kleinen Kindern ein Anfall bei Fieber (Fieberkrämpfe). Viele Störungen und Reizungen des Gehirns können beim Menschen zu epileptischen Anfällen führen.
Nicht alles, was zuckt, sind Zeichen epileptischer Anfälle. Es gibt eine Reihe anfallsartiger Zustände, die kein epileptischer Anfall sind und die nicht als solche diagnostiziert werden müssen. Fehlentscheidungen in beide Richtungen sind nicht selten und haben für den Patienten erhebliche negative Konsequenzen.